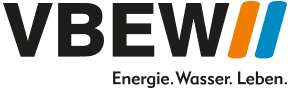VBEW-Positionen zur Windkraft
Die Windkraft ist ein unverzichtbarer Teil des bayerischen Strommix. Genügend Wind gibt es an vielen Stellen im Freistaat und schon heute können rund 6 % des wachsenden bayerischen Stromverbrauchs im Jahressaldo damit gedeckt werden.
Der massive Ausbau erneuerbarer Energien ist ein erklärtes Ziel in der Bayerischen Energiewende und findet grundsätzlich eine große Zustimmung in der Bevölkerung. Windkraft ist die Energieform, die auch in Bayern noch großes Ausbaupotenzial aufweist und einen hohen Stromertrag zu vergleichsweise geringen Kosten liefert. Unter Berücksichtigung der windhöffigen Eignung können praktisch auf jeder freien Fläche und selbst in Waldgebieten Windkraftanlagen mit unterschiedlichster Größe errichtet werden. Windkraftanlagen haben eine gute Ökobilanz, auch wenn der gesamte Energieaufwand für Herstellung, Nutzung und Entsorgung mit einbezogen wird.
Eine wichtige Eigenschaft der Windkraft liegt darin, dass Wind auch bei „schlechtem“ Wetter und in der kalten und dunklen Jahreszeit verfügbar ist. Dadurch stellt sie ein Komplementär zur Photovoltaik dar, da diese im Sommer aufgrund der vielen Sonnenstunden und der längeren Tage umfangreich verfügbar ist, wenn die Windkraft regelmäßig weniger zur Stromversorgung beiträgt. Darüber hinaus eignen sich insbesondere große Windparks mit mehreren Anlagen in Stromüberschusszeiten für die Produktion von klimaneutralem Wasserstoff, da sie mit entsprechend dimensionierten Elektrolyseuren und Speichern ausgestattet werden können. Überschussstrom kann so in Form von Wasserstoff vor allem im Winter die Versorgungssituation stützen.
In Bayern ist der Ausbau der Photovoltaik in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen und ist auch weiter voranzutreiben. Die Photovoltaik wird den Großteil der fluktuierenden Stromerzeugung in Bayern leisten müssen. Um eine sichere Stromversorgung auch im Winter zu ermöglichen, muss neben der Stromerzeugung aus Wasserkraft und Biomasse auch die Windenergie zum Einsatz kommen.
Um die Energiewende fortführen zu können, ist deswegen dem Ausbau der Windkraft in Bayern wieder neuer Schwung zu geben. Die Windenergie ist für unser Bundesland die zweite tragende Säule beim Ausbau der heimischen Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien. Gemäß der FfE-/VBEW-Studie „Bayernplan Energie 2040“ wird im Jahr 2040 eine installierte Windkraftleistung von 14 GW (derzeit ca. 2,6 GW installiert) benötigt.
Derzeit stockt der Windkraftausbau in Bayern noch. Es werden aber in allen Planungsregionen in Bayern Vorranggebiete für die Windkraftnutzung erarbeitet. Dabei müssen die Notwendigkeiten einer klimaneutralen Energieversorgung mit den berechtigten Interessen der Menschen vor Ort, also auf dem Land, in Einklang gebracht werden.
Die Bayerische Staatsregierung ist aufgefordert, weiter verstärkt für die Akzeptanz der Windkraft in Bayern zu werben und der Bevölkerung die vielen Vorteile einer Energieversorgung auf Grundlage heimischer erneuerbarer Ressourcen zu vermitteln.
Bayern soll gemäß Bayerischem Klimaschutzgesetz bis spätestens 2040 klimaneutral sein. Der VBEW unterstützt das Ziel der Klimaneutralität, mahnt aber zugleich, dass die erforderlichen konkreten Maßnahmen von epochaler Dimension sind und mit Schnelligkeit umgesetzt werden müssen, um das Ziel rechtzeitig zu erreichen. Nur mit einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien können die verbliebenen fossilen Kraftwerke ersetzt werden und teure Stromimporte aus Kernkraft und Kohle vermieden werden. Die Windkraft muss bei diesem Ausbau eine der Schlüsselrollen einnehmen. Die noch vielen ungenutzten Potenziale müssen dafür auch in Bayern genutzt werden.
Sowohl für die direkte Stromnutzung als auch für die Produktion klimaneutraler Gase ist eine ausreichende Erneuerbare Erzeugungsleistung notwendig, die möglichst kontinuierlich zur Verfügung steht. Der Ausbau muss schnellstmöglich wieder beschleunigt werden. Wir brauchen mindestens zwei große Windräder pro Woche in Bayern bis 2040! Wenn wir die Jahrhundertaufgabe Klimaneutralität in den verbleibenden 16 Jahren schaffen wollen, müssen alle Erneuerbaren Energieträger ausgebaut werden, aber besonders bei der Windenergie hat Bayern Nachholbedarf, um den geringen Zubau in den letzten Jahren wieder aufzuholen.
Im Jahres- und Tagesmittel ist die Windenergie ein natürlicher Partner der Photovoltaik. Bei schlechtem Wetter weht oftmals viel Wind, bei sonnigem Wetter herrscht eher Windstille. Im Winterhalbjahr spielt die Windenergie ihre Vorteile aus, wenn PV-Anlagen naturgemäß sehr wenig zur Stromerzeugung beitragen. Und auch in der Nacht, wenn die Photovoltaik keinen Beitrag leistet, kann die Windkraft zur Verfügung stehen.
Der Stromversorgungsbeitrag der Windenergie ist einige Tage im Voraus gut prognostizierbar. Durch einfaches Steuern der Windkraftanlagen, der Einbindung von Speichersystemen sowie der Elektrolyseure zur Wasserstoffherstellung ist die Windkraft sehr gut in das Energieversorgungssystem integrierbar. Der Jahresstromertrag je installiertem MW ist etwa doppelt so hoch wie bei der Photovoltaik, da Wind öfter weht als die Sonne scheint. Moderne Anlagen mit großer Bauhöhe liefern einen gleichmäßigeren Ertrag als ältere kleinere Windräder. Insofern liegen im Repowering erhebliche Potenziale zur Steigerung der Stromproduktion aus Windkraft.
Fläche wird bei der Windkraft im klassischen Sinne kaum „verbraucht“, denn unter der Windanlage ist Landwirtschaft fast ohne Einschränkungen weiter möglich. Windkraft und Bioenergie ergänzen sich demnach ebenfalls sehr gut, denn auf dem gleichen Acker können sowohl Windkraftanlagen stehen als auch Pflanzen für Energie- und Nahrungsmittelproduktion angebaut werden. Bayern mit seiner traditionell starken Landwirtschaft hat entsprechend sehr viele Flächen, die zusätzlich für die Windenergie genutzt werden können. In ähnlicher Weise sollten Windkraft- und Photovoltaikanlagen als Hybridkraftwerke kombiniert werden. Auf diese Weise kann der Netzausbau vermindert und gleichzeitig die Stromproduktion verstetigt werden.
Windkraftanlagen reduzieren den Stromspeicherbedarf, der bei einer einseitig auf Photovoltaik ausgerichteten Stromversorgung entstehen würde, da diese in den dunklen Monaten bei hohem Strombedarf kaum zur Verfügung steht.
Die Planung und der Bau von Windkraftanlagen sind besonders in Bayern mit erheblichen bürokratischen Hürden verbunden. Im Gegensatz zur flächenintensiveren Energiegewinnung aus Biomasse (insbesondere Biogas) sind erhebliche Restriktionen und langwierige Genehmigungsverfahren eine große Hürde. Als Standort kommt in Deutschland de facto nur in Frage, was in den Plänen der regionalen Planungsverbände als Vorranggebiet für Windenergie ausgewiesen wurde und einer ausführlichen naturschutzrechtlichen Prüfung standhält. Daher blieb in Bayern in der Vergangenheit wenig Platz für die Windenergie. Die Anforderungen an die Genehmigungsverfahren sind daher zu verschlanken.
Wir begrüßen die Beauftragung der Regionalen Planungsverbände mit der Aufgabe für jede Region 1,1 % der Regionsfläche bis zum 31.12.2027 als Vorranggebiet für die Windkraftnutzung an Land auszuweisen. In einem zweiten Schritt soll bis zum 31.12.2032 bayernweit 1,8 % der Landesfläche ausgewiesen werden. Dabei sollte auch die Windhöffigkeit eine besondere Rolle spielen und damit auch von der prozentual gleichen Aufteilungsquote pro Planungsregion abgewichen werden können.
Windkraftanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Dennoch müssen bei der Errichtung von Windkraftanlagen die Folgen für die Natur und die lokale Tierwelt abwägend mit der Bedeutung für die klimaneutrale Energieerzeugung berücksichtigt werden. Windenergie und Naturschutz stehen dabei nicht im Gegensatz, umfangreiche naturschutzrechtliche Prüfungen in den regionalen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren garantieren eine umweltverträgliche Lösung. Es gilt, den Artenschutz zu gewährleisten, ein Individualschutz für jeden einzelnen Vogel und jede Fledermaus wird jedoch nicht umsetzbar sein. Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert.
Der VBEW unterstützt die jüngst auf EU- und Bundesebene beschlossenen Vereinfachungen, Klarstellungen und Vereinheitlichungen der artenschutzrechtlichen Prüfungen und Standards und fordert die bayerische Staatsregierung auf, noch existierende Interpretationslücken durch Hilfestellungen und Leitlinien an alle Beteiligten im Sinne einer Beschleunigung und Vereinfachung der Genehmigungsverfahren wo notwendig schnellstmöglich zu schließen.
Durch technische Innovationen konnten unerwünschte Auswirkungen von Windkraftanlagen in den letzten Jahren weiter reduziert werden. Anlagen über 100 Meter Höhe müssen z. B. eine Nachtkennzeichnung haben, um anfliegende Flugzeuge zu warnen, jedoch wurde das Blinken von den Anwohnern oft als störend empfunden. In neueren Windparks überwacht jetzt eine sog. Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung den Luftraum, so dass die Nachtkennzeichnungen nur noch dann angeschaltet werden müssen, wenn sich tatsächlich ein Flugzeug in der Nähe befindet. Neuerdings gibt es auch Vogelortungssysteme zum Schutz von Zugvögel, die Windkraftanlagen bei Erfordernis abschalten können.
In sensiblen Gebieten gelten besondere Vorschriften bei der Ausweisung von Windkraftstandorten. So werden etwa Laubwälder und Flächen mit besonders hoher ökologischer Wertigkeit oder Bedeutung für den Fremdenverkehr von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Forstwirtschaftlich genutzte Nadelwälder und Monoforstkulturen können dagegen günstige Standorteigenschaften für Windanlagen haben, wie beispielsweise vorhandene Zufahrten, die bereits für forstwirtschaftliche Fahrzeuge errichtet wurden. Es werden bei neuen Standorten auch ökologische Ausgleichsmaßnahmen eingeplant, etwa für Aufforstungen oder Schutzgebiete für Vogelarten.
Auch Tourismus und Windenergie müssen kein Widerspruch sein, wie Untersuchungen in verschiedenen Ferienorten gezeigt haben. Nur sehr wenige Gäste würden einen Urlaubsort wegen eines Windparks in der Nähe meiden. Es können sich sogar Imagegewinne durch Windkraftanlagen für einen Ort ergeben, da diese zunehmend für Innovationskraft, Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit stehen. Das gleiche gilt für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe in der Nähe von Windkraftanlagen.
Somit kann jede Region in Bayern an geeigneten Standorten ihren Beitrag zur Stromproduktion aus Windkraft leisten.
Windenergie ist eine ertragsstarke fluktuierende Energieform. Dank der bisherigen Investitionen und der EEG-Förderung sind die Preise je kWh teilweise unter das Niveau der fossilen Energieträger gesunken. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund des steigenden CO2-Preises und entsprechender Marktentwicklungen Windkraft in Zukunft generell günstiger sein wird im Vergleich zur Stromerzeugung aus fossilen Energien. Wie bei allen fluktuierenden Energien werden aber noch weitere Investitionen für Speicher, Netze und Ausgleichskraftwerke erforderlich, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten (Stichwort: Dunkelflaute).
Windparks werden auch im Süden Deutschlands wirtschaftlich betrieben. Technische Innovationen und große Bauhöhen machen es heute möglich, dass bereits bei relativ niedrigen Windgeschwindigkeiten ein sinnvoller Stromertrag erzielt wird. Wird Windstrom direkt in Bayern erzeugt, hat das zusätzliche Vorteile, da die Transportwege kürzer werden. So sinken die Kosten für den Netzausbau und die Übertragungsverluste fallen weniger ins Gewicht.
Für eine Nutzung der heimischen Windenergie spricht zudem, dass Bayern unabhängiger von Rohstoffimporten wird. Wind ist eine der wenigen Ressourcen, die in unserem Bundesland kostenlos verfügbar ist. Auch die Fertigung der Windanlagen erfolgt meistens im Inland, so dass im Gegensatz zu Stromimporten die Wertschöpfung größtenteils in Deutschland und in Bayern verbleibt.
Die Investitionskosten in eine Windkraftanlage sind erheblich und fallen im Wesentlichen vor deren Inbetriebnahme an. Die Investition wird nur getätigt, wenn diese über viele Jahre verlässliche Erträge liefern kann. Die Windenergie braucht daher langfristige Planungssicherheit und stabile Rahmenbedingungen, auch um Kommunen und die Bürgerschaft als Finanzierungspartner für Projekte zu gewinnen.
Bei Windkraftanlagen ist zudem schon im Vorfeld eine umfangreiche und viel Zeit in Anspruch nehmende Projektplanung erforderlich. Damit diese Ressourcen möglichst effizient eingesetzt werden, sind verständliche und unbürokratische Genehmigungsverfahren dringend erforderlich. Insbesondere beim Repowering sind straffe Genehmigungsverfahren der Schlüssel für einen zügigen Windkraftausbau. Eine verlässliche Politik ist gefragt, um Rechtssicherheit für die Investitionen in der Energiewende zu schaffen.
Die erforderlichen Mitarbeiter*innen lassen sich für die Windkraftnutzung nur gewinnen, wenn sie in diesem Wirtschaftszweig eine langfristige Perspektive finden. Der Fachkräftemangel stellt die Anlagenbetreiber vor erhebliche Probleme, wenn z. B. notwendige Wartungsarbeiten nur mit Verzögerung durchgeführt werden können. Denn an jedem Tag, an dem die Anlage nicht läuft, kann sie auch keinen Beitrag leisten, die Investitionskosten zu amortisieren und die Energiewende voranzubringen.
Die Unternehmen der Energiewirtschaft unterstützen das Ziel der Bayerischen Staatsregierung, Bayern bis 2040 zum ersten klimaneutralen Bundesland umzubauen. Die Errichtung neuer Windkraftanlagen ist ein essenzieller Bestandteil, die Stromerzeugung und die Produktion von Wasserstoff ohne CO2-Emissionen bewerkstelligen zu können.
Große Ziele erfordern die partnerschaftliche Zusammenarbeit unterschiedlicher Beteiligter. Der VBEW bietet den windkraftbetreibenden Unternehmen die Zusammenarbeit an, um dem gemeinsamen Anliegen - Windkraftausbau in Bayern - Nachdruck zu verleihen und es bei den Entscheidungsträgern vorzubringen. Mit einem Memorandum of Understanding (MoU) unter Federführung des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) haben maßgebliche Organisationen wie der VBEW und Stromverteilernetzbetreiber im Rahmen der StMWi-Initiative „Verteilnetz und erneuerbare Energien“ ihr gemeinsames Verständnis für eine besser Koordination des Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Verteilnetzausbaus in Bayern festgehalten. Der VBEW hat seine Mitglieder um Unterstützung bei der Umsetzung der im MoU dokumentierten Aspekte gebeten.
Durch die Einspeisung von Strom aus Wind und Sonne ergeben sich neue Herausforderungen für die Stromnetze, für die diese ursprünglich nicht ausgelegt waren. Es wird sowohl ein Ausbau der Verteilernetze erforderlich sein, um Strom aus Windkraftanlagen in Bayern vor Ort einspeisen zu können, als auch der Übertragungsnetze, um den Windstrom über längere Entfernungen zu transportieren. Die Nord-Süd-Verbindungen SuedLink und SuedOstLink müssen schnellstmöglich fertiggestellt werden, um überschüssigen Windstrom aus Norddeutschland auch in Bayern nutzen zu können. Der insgesamt notwendige Netzausbau kann aber durch systemdienliche Speicherung der Einspeisespitzen vor Ort und intelligente Anlagenkonzepte mit der Erzeugung von Wasserstoff signifikant reduziert werden.
Als Speicher für Windstrom eignen sich auch „Second-Life-Batterien“ aus dem Elektromobilitätssektor. Diese können in Containern direkt als Teil eines Windparks integriert oder in der Nähe angeordnet werden, genauso wie Elektrolyseure zur Wasserstoffproduktion. Beides trägt zur Vermeidung von Einspeisespitzen und zur Netzentlastung bei.
Die Energiewende und die Abkehr von fossilen Brennstoffen zur Stromerzeugung genießen bei der überwiegenden Mehrzahl der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz. Die meisten Bürgerinnen und Bürger unterstützen den Weg der Staatsregierung, die weggefallenen Kernkraftwerke möglichst durch Strom aus erneuerbaren Energien zu ersetzen und die Klimaneutralität bis 2040 zu erzielen. Die Bayerische Staatsregierung sollte sich von den wenigen Windkraftgegnern nicht verunsichern lassen. Sie sollte die Befürworter und nicht deren Gegner stärken.
Wie dargelegt, ist ein bedarfsgerechter Ausbau der Windenergie für die sichere, bezahlbare Stromversorgung in Bayern unerlässlich. Die inzwischen verhärtete Auseinandersetzung zwischen Windkraftgegnern und -befürwortern kann sich unser Land nicht länger leisten. Der VBEW wirbt deswegen für einen bayerischen Weg, der den raschen Ausbau der Windenergie überall dort, wo er sinnvoll ist, auch ermöglicht und bedankt sich bei der Bayerische Staatsregierung, dass sie dem dafür erforderlichen Dialog wieder neuen Schwung gegeben hat.
Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. - VBEW
Stand: 11.10.2023
Az 182